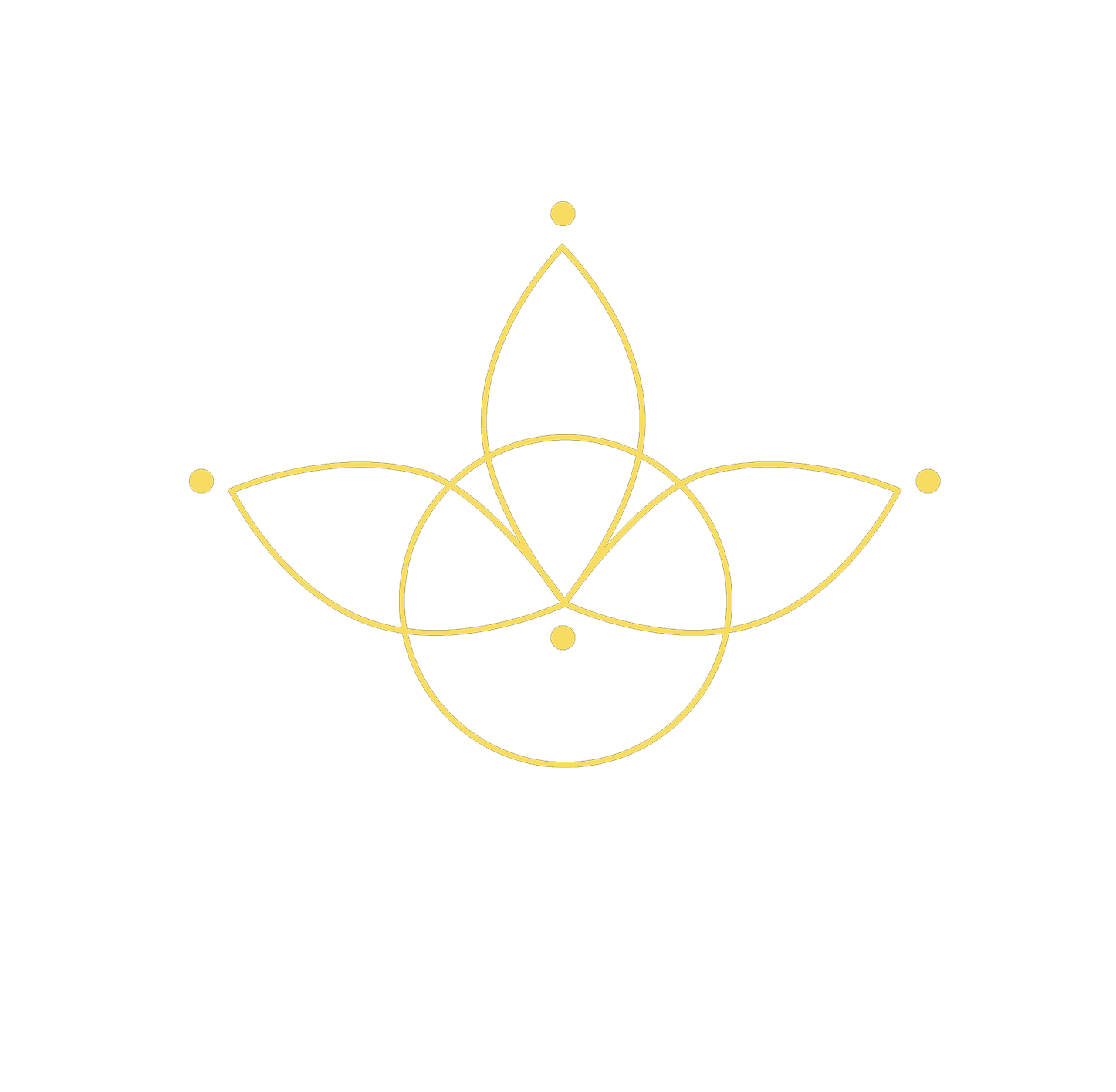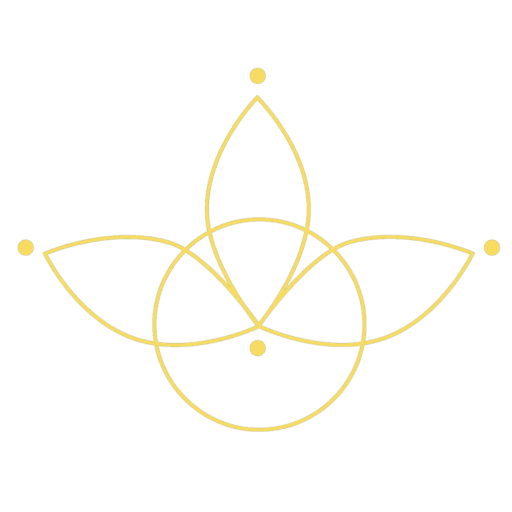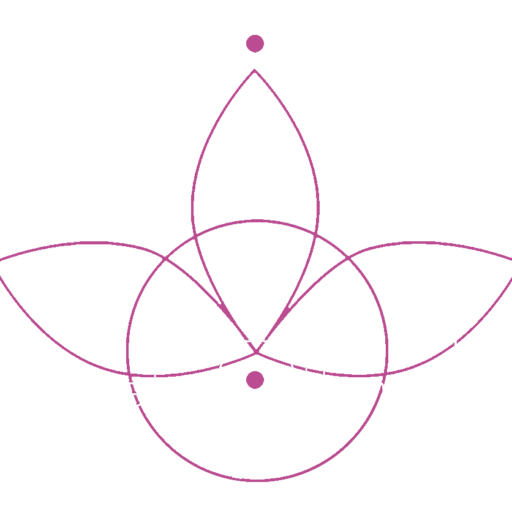Irgendwann bin ich kurz aus der Gruppe verschwunden. Ein kleiner Umweg, ein Moment für mich. Ich habe Fotos gemacht, gespielt, den Raum genossen. In der Ferne habe ich mich an einem roten Punkt orientiert – einer roten Jacke. Sie gab mir Richtung, ein Gefühl von Verbindung. Gleichzeitig trug ich innerlich ein anderes Bild in mir: den Zugang zu unserem Haus. Zwei Orientierungen. Zwei innere Karten.
Und dann war ich plötzlich allein.
Ich hatte mich verlaufen – mitten in der Weite. Nicht laut, nicht dramatisch. Eher still. Ein Hin- und Hergehen zwischen Vertrauen und Zweifel. Irgendwann habe ich mich hingelegt, direkt in den verschneiten Boden. Ich habe aufgehört zu suchen und begonnen zu fühlen. Müdigkeit. Unsicherheit. Hingabe. Der Körper war ehrlich, kompromisslos ehrlich.

In der Nacht kam der Traum. Nicht zufällig. Nicht getrennt von diesem Tag. Der Traum hat aufgenommen, was der Körper vorbereitet hatte. Er hat weitergeführt, was am Strand begonnen hat. Bilder, die nicht erklären, sondern erinnern. Dass Vertrauen nicht heißt, immer zu wissen, wo es langgeht. Sondern zu bleiben, wenn das Wissen endet. Dass Verlaufen kein Fehler ist, sondern manchmal ein Übergang.
Heute fühlt es sich an, als hätte dieser Tag mir etwas zurückgegeben: eine tiefere Form von Orientierung. Eine, die nicht im Außen liegt. Sondern im Spüren. Im Zulassen. Im Anerkennen der eigenen Grenzen. Und im Vertrauen darauf, dass jeder Umweg eine Bedeutung trägt – auch wenn sie sich erst später im Traum zeigt.