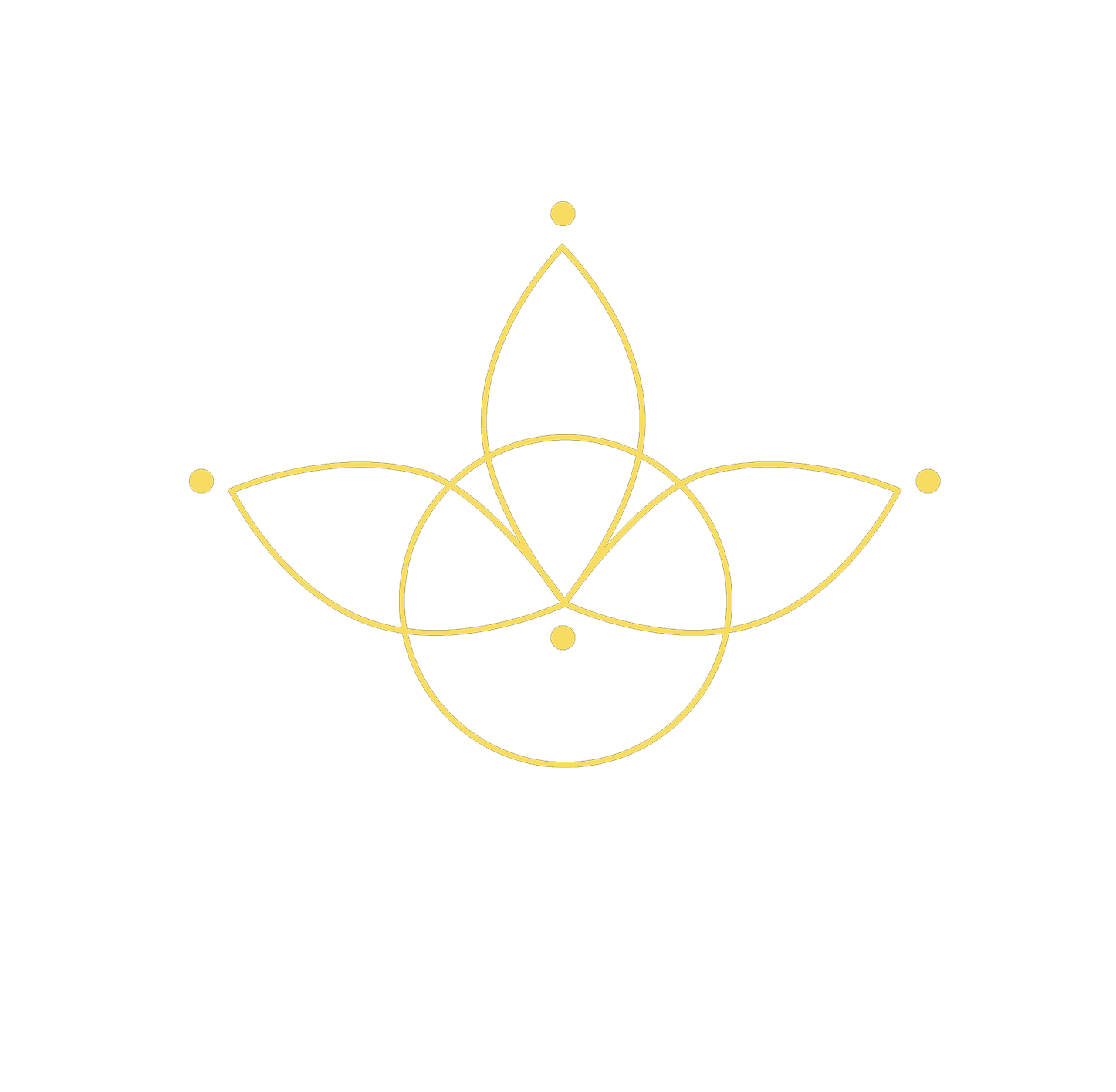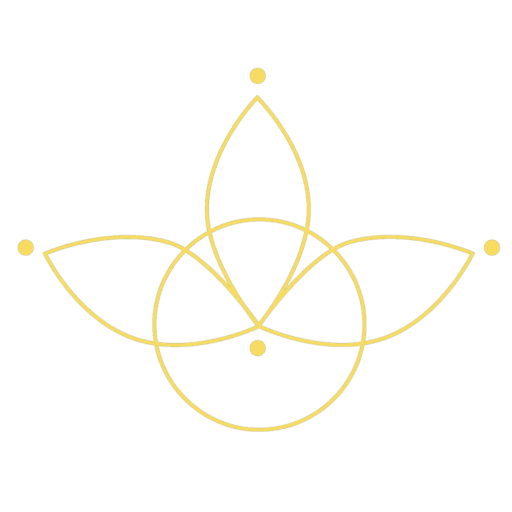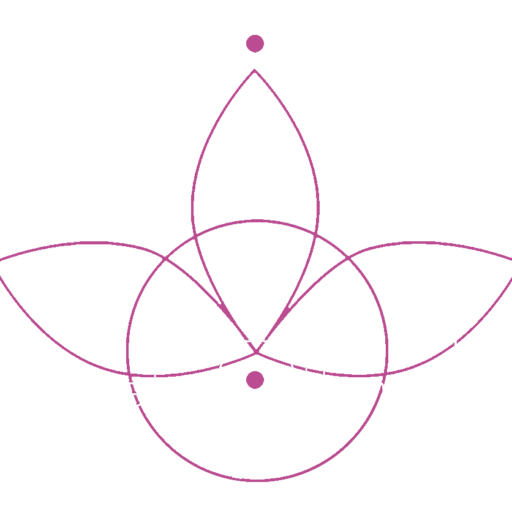Es gibt einen Moment im Abschied, der sich nicht wie Freiheit anfühlt, sondern wie ein Innehalten. Etwas fällt weg. Und was bleibt, ist Raum. Nicht der weite, lichte Raum, von dem so oft gesprochen wird, sondern ein stiller, ungewohnter Raum, in dem nichts sofort greift. Loslassen ist dann kein aktiver Schritt. Es ist ein Nachgeben.
Ein Aufhören, dagegenzuhalten. Ein leises Eingeständnis: So, wie es war, trägt es mich nicht mehr. Dieser Raum fühlt sich zuerst leer an. Und genau darin liegt seine Zumutung. Denn wir sind es gewohnt, Leere zu füllen, sie zu erklären, sie zu übergehen. Doch dieser Raum will nichts von uns. Er will gehalten werden. Mit Atem. Mit Geduld. Mit der Erlaubnis, dass sich noch nichts Neues zeigen muss.
Innere Sicherheit wächst hier nicht aus Gewissheit, sondern aus dem Bleiben. Aus dem Dableiben, wenn etwas gegangen ist. Aus dem Spüren, dass ich noch da bin, auch wenn ich nichts festhalte. Der Abschied trennt nicht einfach. Er ordnet neu. Er verschiebt die Verbindung vom Außen nach innen.
In diesem Raum beginnt etwas zu wirken, das sich nicht erzwingen lässt. Vertrauen entsteht nicht als Gedanke, sondern als Erfahrung: Ich falle nicht, auch wenn ich loslasse. Fülle zeigt sich nicht als Mehr, sondern als Genug. Nicht laut. Nicht grenzenlos. Aber tragfähig. Alles ist verbunden. Nicht, weil es keine Grenzen gäbe, sondern weil Übergänge dazugehören.
Und vielleicht ist genau dieser Raum, der sich öffnet, wenn wir lassen, um loszulassen, der Ort, an dem wir unseren eigenen Weg nicht suchen müssen – sondern langsam betreten.